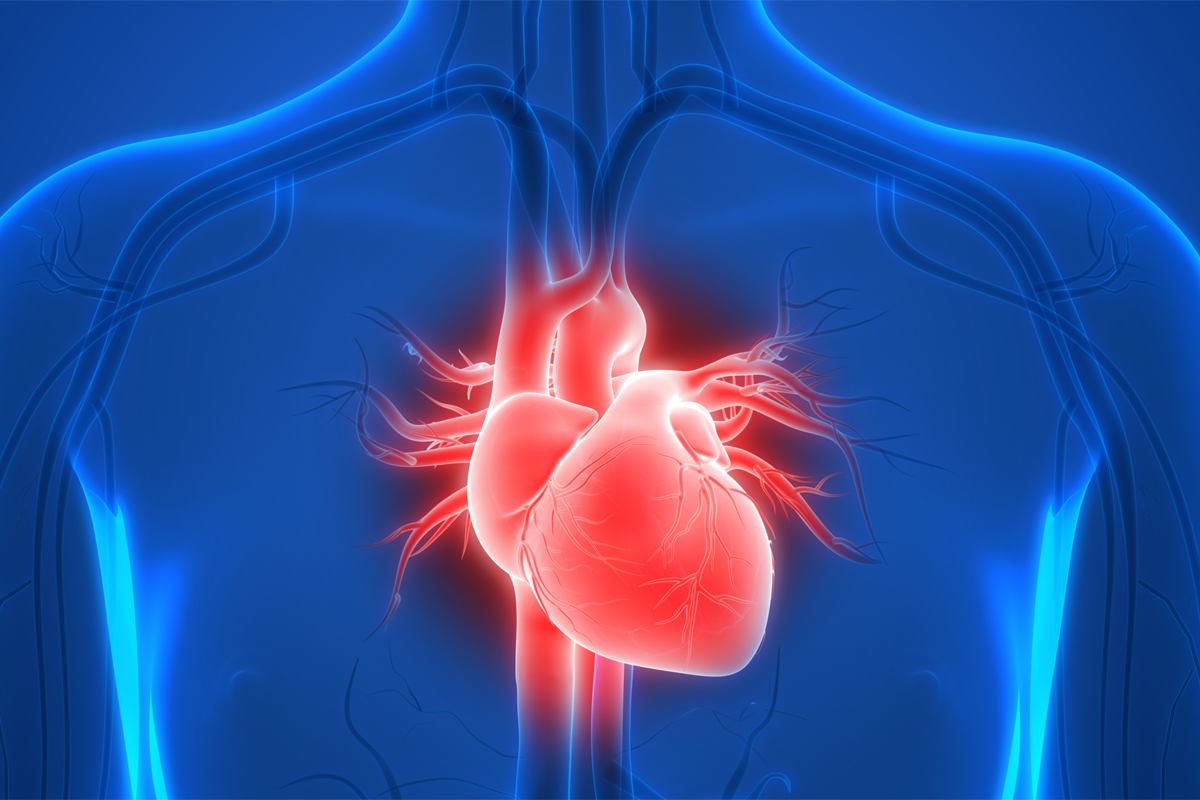Ob dieses sogenannte Telemonitoring Patienten bei Herzinsuffizienz oder bei Herzrhythmusstörungen mit hoher Herzfrequenz (ventrikuläre Tachyarrhythmien) Vorteile bietet, bleibt jedoch unklar. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) in seinem Abschlussbericht. Nach wie vor fehlen zu unerwünschten Ereignissen und zur Lebensqualität Daten, da Studienergebnisse nicht oder nur lückenhaft veröffentlicht wurden.
Auch der öffentliche Aufruf des IQWiG änderte daran nichts. Bei anderen Zielkriterien fallen die Behandlungsergebnisse mit Telemonitoring weder besser noch schlechter aus als ohne. Herzinsuffizienz, also Herzschwäche, ist eine häufige Erkrankung gerade bei älteren Menschen und gehört zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Sogenannte ventrikuläre Tachyarrhythmien treten bei Herzinsuffizienz häufig auf. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Herzrhythmusstörung (Arrhythmie) und schnellem Herzschlag (Tachykardie), die von einer der beiden Herzkammern (Ventrikel) ausgeht.
Sie können im schlimmsten Fall einen plötzlichen Herztod verursachen. Beide Erkrankungen werden behandelt, indem man den Betroffenen aktive kardiale Aggregate implantiert. Ist der Herzschlag auffällig, senden diese Geräte elektronische Impulse aus. Sie sollen entweder eine Defibrillation oder eine Überstimulation auslösen (ICDs) oder die Kontraktion von linker und rechter Herzkammer synchronisieren (CRTs). Ein dritter Gerätetyp kombiniert beide Funktionalitäten (CRT-Ds).
Telemonitoring soll Nachsorge unterstützen
Unabhängig vom Typ des Implantats ist eine regelmäßige (ambulante) Nachsorge notwendig, wobei Patienten in festen Zeitabständen, in der Regel alle drei Monate, zu ihrem Arzt oder zu ihrer Ärztin kommen müssen. Prinzipiell ermöglichen heutzutage aber alle Gerätetypen auch das sogenannte Telemonitoring. Dabei werden physiologische Daten per Funk an die Praxis oder eine andere medizinische Einrichtung übermittelt und überwacht.
Die Patienten können dann bei Bedarf unabhängig von den regulären Nachsorgeterminen einbestellt werden, um diagnostische oder therapeutische Maßnahmen einzuleiten. Das Telemonitoring soll den Arztbesuch aber auch teilweise ersetzen können. Bereits beim Vorbericht hatte dem Institut eine, für nichtmedikamentöse Verfahren, relativ breite Datenbasis zur Verfügung gestanden. Und durch eine Nachrecherche kam eine weitere Studie hinzu. Insgesamt flossen nun 17 Studien mit 10 130 Teilnehmern in die Bewertung ein.
In diesen Studien erhielten die Teilnehmer entweder nur die Standardnachsorge oder sie wurden zusätzlich per Telemonitoring überwacht. Bei den meisten Zielkriterien, den sogenannten Endpunkten, zeigen die Daten keine oder keine relevanten Unterschiede zwischen den beiden Behandlungsgruppen. Für die Sterblichkeit und das Auftreten von Schlaganfällen oder Herzinfarkten gilt das ebenso wie für die Notwendigkeit von Klinikaufenthalten oder das Auftreten von psychischen Problemen.
Besonderheiten im Studienaufbau von IN-TIME
Es gibt indes eine Ausnahme: Bei einer der 17 Studien (IN-TIME) fallen die Ergebnisse in Hinblick auf die Sterblichkeit (Gesamtmortalität und kardiovaskuläre Mortalität) zugunsten der telemedizinischen Versorgung aus. Allerdings war bei IN-TIME der Studienaufbau auch besonders: Zum einen wurden die Teilnehmer besonders engmaschig überwacht.
Zum anderen war die Nachsorge in der Kontrollgruppe, im Unterschied zu der in Deutschland üblichen Versorgung, weniger intensiv: Erst nach 12 Monaten mussten die Patienten zum ersten Mal persönlich in die Arztpraxis, um sich untersuchen zu lassen. Somit bleibt unklar, ob die Resultate von IN-TIME auf die besonders engmaschige Beobachtung in der Telemedizin-Gruppe oder aber auf die, im Vergleich zu den anderen Studien, selteneren Nachsorgetermine in der Kontrollgruppe zurückzuführen sind.
Das Institut leitet deshalb auch aus IN-TIME keinen Nutzen ab. Bei zwei zentralen Endpunkten, bei Nebenwirkungen und Lebensqualität, sind in der Gesamtschau der Studien weiterhin gar keine Aussagen zu Nutzen oder Schaden möglich, weil hier die Daten für einen erheblichen Anteil der Patienten fehlen.
Was schwerwiegende unerwünschte Ereignisse betrifft, zu denen auch Nebenwirkungen der Therapie zählen, sind für 42 Prozent der Teilnehmer die Ergebnisse nicht verfügbar. Bei der gesundheitsbezogenen Lebensqualität sind es sogar 82 Prozent. Nur diejenigen Teilnehmer in die Bewertung einzubeziehen, für die Angaben vorliegen, wäre nicht adäquat. Denn bei einem derart hohen Anteil fehlender Daten ist die Wahrscheinlichkeit für ein verzerrtes Ergebnis sehr hoch.
Mehrere Studien noch immer nicht publiziert
Doch es fehlen nicht nur Angaben von Studienteilnehmern. Drei Studien, die für die Bewertung wahrscheinlich relevant sind, waren zu Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht. Das IQWiG hat zudem fünf weitere abgeschlossene, noch unpublizierte Studien identifiziert. Allerdings war deren Relevanz unklar.
Unter diesen Studien ist auch die EVATEL-Studie: Sie wurde vor mehr als sechs Jahren abgeschlossen, bislang ist aber lediglich ein Abstract verfügbar. Obwohl das IQWiG diesen Umstand vor dem Stellungnahmeverfahren kritisiert hatte, lieferten weder Hersteller noch Studienautoren aus öffentlich finanzierten Einrichtungen Daten nach.
„Hier hat gerade die Industrie die Chance vertan, einen Nutzen ihrer Geräte aufzuzeigen“, kommentiert der stellvertretende Leiter des IQWiG, Stefan Lange. „Klinische Studien haben keinen Selbstzweck, vielmehr müssen alle ihre Resultate so rasch wie möglich öffentlich verfügbar sein. Denn nur dann können wir Nutzen und Schaden der medizinischen Interventionen bewerten. Und Patientinnen und Patienten können ohne dieses Wissen keine informierte Entscheidung treffen“, so Stefan Lange.
Quelle: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)