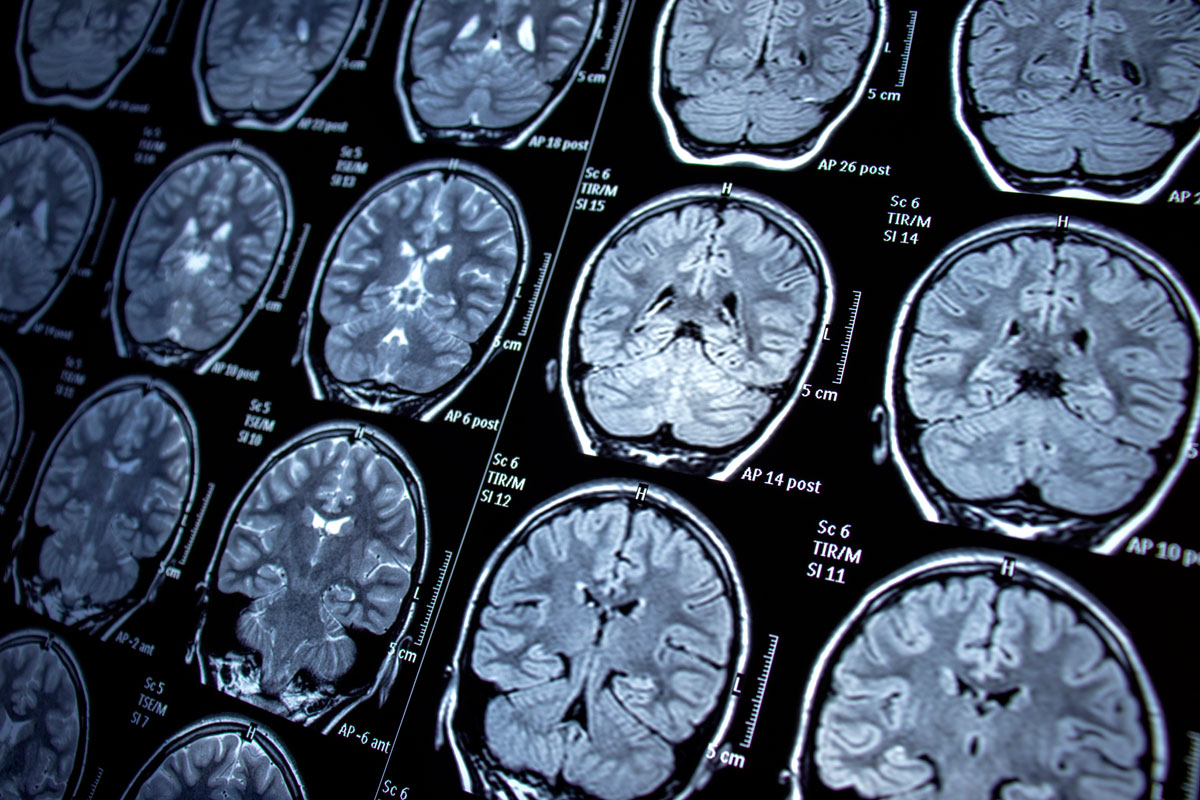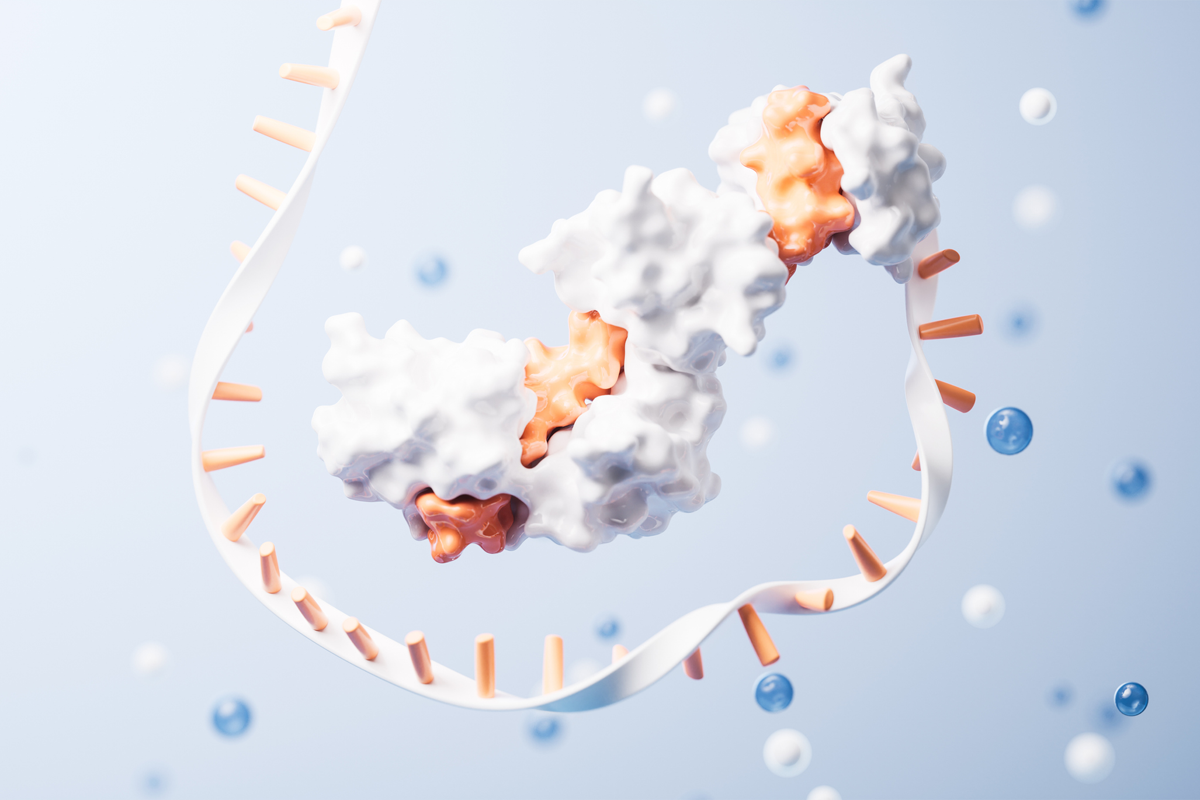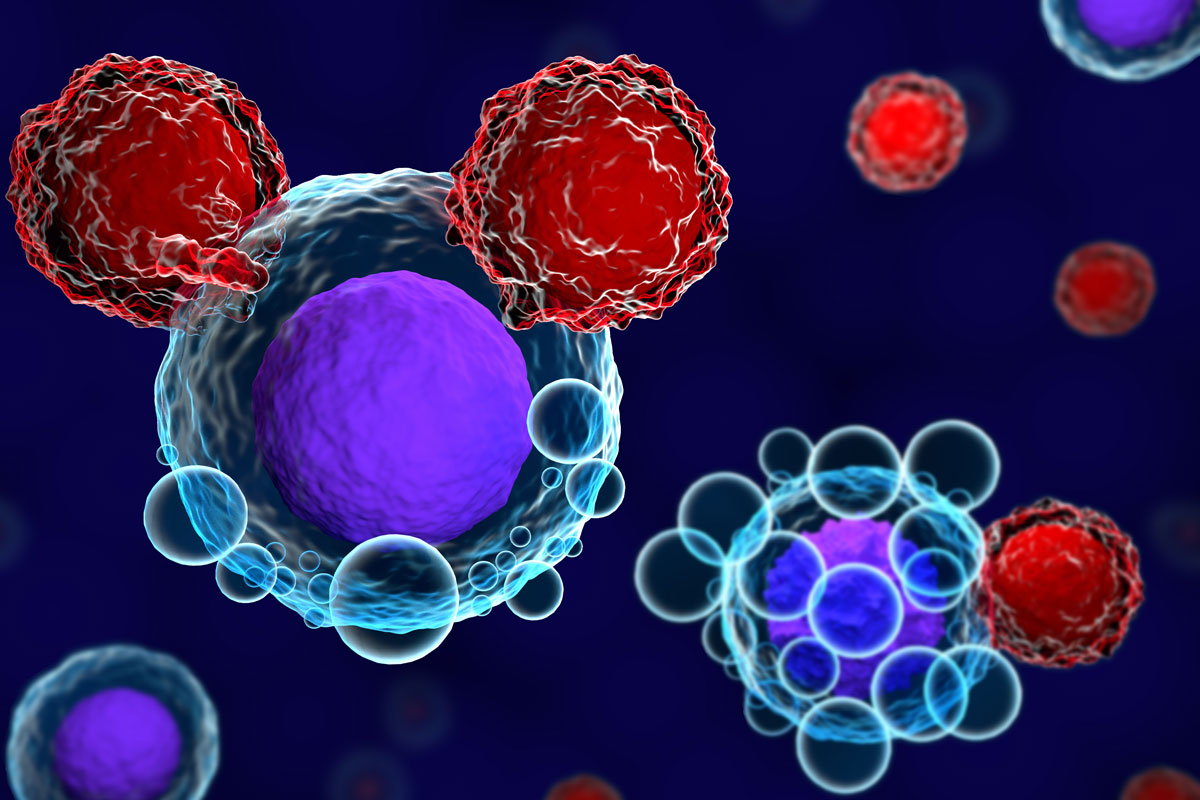Forschende der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld haben deutschlandweit 675 Studierende an Hochschulen gefragt, welche Anwendungen sie nutzen, welche Motive sie haben und in welchen Bereichen die jungen Erwachsenen Potenziale, aber auch Risiken der Technik sehen. „Für uns ist es entscheidend zu sehen, was letztendlich die Techniknutzung im Gesundheitsbereich beeinflusst und welche Einstellungen, Haltungen und Wissensbestände ausschlaggebend sind, dass ein Mensch das Gerät in die Hand nimmt und anfängt, seine Gesundheit selber zu kontrollieren“, sagt Gesundheitswissenschaftler Christoph Dockweiler.
Die Ergebnisse der Bielefelder Studie zeigen, dass ein Drittel der Befragten gesundheitsbezogene Applikationen (Apps) auf ihrem Smartphone nutzt. Über 70 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer kontrollieren ihr tägliches Bewegungspensum oder ihr Schlafverhalten in der Nacht. Jeder Zweite setzt die Apps während des Sports ein, etwa um die Herzfrequenz oder Laufstrecken aufzuzeichnen. Weniger im Fokus der jungen Zielgruppe stehen dagegen Applikationen, die einen konkreteren Bezug zu medizinischen Themen haben – zum Beispiel Ärzteregister, Apps zur Stressbewältigung oder zur Online-Vernetzung unter Patientinnen und Patienten.
Qualitätssicherung
Laut Studie nutzen angehende Akademikerinnen und Akademiker die Programme, um ihren Gesundheitszustand besser einschätzen zu können und um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Dabei wünschen sich 78 Prozent künftig, dass Ärztinnen und Ärzte sie beraten, wie sie die Technik richtig einsetzen können. Gleichzeitig zeigen sie sich in der Theorie höchst sensibel für Fragen des Datenschutzes. Über 90 Prozent erwarten hier eine Sicherung der Qualität von Gesundheits-Apps und Informationen darüber, wie ihre Gesundheitsdaten verwendet werden.
Gerade hierbei kommen die Bielefelder Forscherinnen und Forscher zu erstaunlichen Ergebnissen. Steht ein junger Erwachsener vor der Wahl, eine Gesundheits-App zu installieren und zu nutzen, sind die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes nicht mehr das Ausschlaggebende. Viel entscheidender sei, so Dockweiler, wie groß der Gesundheitsgewinn eingeschätzt wird, wie andere Nutzerinnen und Nutzer sowie Freundinnen und Freunde die App bewerten und ob anfallende Kosten selber zu tragen sind. Christoph Dockweiler: „Gerade mit Blick auf Risiken wie den Datenmissbrauch zeigt sich hier ein bemerkenswerter Verdrängungsprozess, der allerdings auch damit einhergeht, dass das bisherige Wissen der Nutzerinnen und Nutzer zu gering ist. Gerade mal jeder Dritte fühlt sich ausreichend informiert über die potenziellen Risiken der Nutzung.“
Die Forscherinnen und Forscher sehen die Studie als Ausgangspunkt für neue Erkenntnisse darüber, wie Gesundheitstechnologien künftig besser auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten und wie sie bei der Anwendung besser unterstützt und informiert werden können.